
Zwangsgedanken
Was sind Zwangsgedanken?
Zwangsgedanken (diagnostisch im ICD-10 verbunden mit der „Zwangsstörung“) sind als unangenehm erlebte, negative Denkprozesse und Vorstellungen, die sich ständig wiederholen. Für die Betroffenen ist es quälend, wenn sie sich Zwangsgedanken ausgeliefert fühlen. Der Wunsch, Zwangsgedanken zu besiegen, verschärft die Problematik. Lesen Sie hier, welche Lösungen es gibt.
Gibt es typische Zwangsgedanken?
Ja, es gibt vermehrt vorkommende Denkmuster. Zu den häufigsten Zwangsgedanken oder Zwangsvorstellungen zählen:
- sexuelle Zwangsgedanken
- blasphemische Gedanken (Gotteslästerung)
- Gewaltphantasien
- Vorstellungen von Unglücken
- „Versündigungswahn“
- „Verschuldungswahn“
Häufig sind mit anankastischen Gedanken Ängste und der Verdacht auf eine Angststörung verbunden:
- Was ist, wenn meine Befürchtungen sich bewahrheiten sollten, also wenn meine Zwangsgedanken zu Handlungen führen, die ich bereue?
- Versündige ich mich?
- Habe ich mich noch unter Kontrolle?
- Wie kann ich verhindern, dass ein schlimmes Ereignis eintritt?
Die betroffenen Menschen machen sich viele Sorgen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. In manchen Fällen kommt es dabei zu Symptomen, die Außenstehende als Angststörung interpretieren.
Zwangsgedanken besiegen – warum geht das nicht?
Verständlicherweise verspüren Menschen den Impuls, aufdringliche Gedanken von sich wegzuschieben, auszublenden oder zu stoppen. Und doch: Niemand kann Zwangsgedanken besiegen. Der Versuch, Gedanken (ob zwanghaft oder nicht, spielt keine Rolle) zu verhindern oder abzuschalten, scheitert aus einem einfachen Grund.
Das Problem beim Kampf gegen zwanghafte Gedanken sieht wie folgt aus:
Wo die Aufmerksamkeit ist, sind die Gedanken. Und umgekehrt. Das Gesetz von Hebb.
Das Hebb’sche Gesetz besagt, dass Zellen miteinander feuern, wenn sie verbunden sind. Und Zellen, die sich verbinden, feuern miteinander.
Wenn Sie nun versuchen, einen bestimmten Gedanken nicht zu denken, stärken Sie genau diesen Gedanken.
Sieht paradox aus, ist aber das Zeichen eines gesunden Gehirns.
Was kann man gegen Zwangsgedanken tun?
Staunen und neu einordnen. Bestaunen Sie Ihren Gedanken und ordnen Sie ihn so ein, dass er Ihren anderen Gedanken Platz macht.
Beim Staunen entsteht weniger Missempfinden als bei Ärger oder bei Druck.
Betrachten Sie also Ihren zwanghaft wirkenden Gedanken von allen Seiten – und staunen Sie darüber, was für ein kreatives Gehirn Sie haben.
Dann suchen Sie sich einen Platz aus, an dem der Gedanke sein kann, während Sie sich mit Ihren erwünschten Gedanken beschäftigen.
Das war es auch schon.
Sie meinen, das wäre zu einfach? Warum aber suchen Sie nach einem schwierigen Weg?
Die Antwort liegt auf der Hand: Zwangsgedanken wirken schwer, so lange der Mensch versucht, gegen sie anzukämpfen, sie zu besiegen: weil das aus Gehirngründen nicht funktioniert.
Deshalb muss auch die Lösung schwer sein. So denkt der Mensch. Komplexes Problem erfordert komplexe Lösung. Doch das ist ein Irrtum.
Das Problem mit den Zwangsgedanken lässt sich mit sanften und kreativen Gedanken lösen.
Hier ist die Lösung
Stellen Sie sich vor, Sie stellen Ihren Zwangsgedanken einen eigenen Raum in Ihrem Kopf zur Verfügung, in dem diese machen können, was sie wollen. Sie laden Ihre Gedanken in diesen Raum ein und gehen Ihren Beschäftigungen nach.
Um wie viel besser wird Ihr Leben aussehen?
Wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie ihren (vermeintlich) zwanghaften Gedanken freiwillig Raum geben?
Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist das Prinzip.
Wie lässt sich diese Ablösung von den Zwangsgedanken praktisch umsetzen?
Der gedankliche Raum kann „Rumpelkammer“ heißen.
Und wie gelingt es, diese Rumpelkammer zu erschaffen?
Das einfache Prinzip steht in „Gedankenwohnung.“
Erfahren Sie hier mehr über Zwangsvorstellungen und ihren Einfluss auf die mentale Gesundheit.
Lesen Sie 11 Seiten kostenlos im E-Book „Gedankenwohnung“
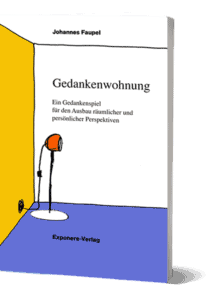 Laden Sie sich hier die kostenlose Leseprobe von Gedankenwohnung herunter.
Laden Sie sich hier die kostenlose Leseprobe von Gedankenwohnung herunter.
„Herrlich, Ihre Ausführungen zur Gedankenwohnung. Passt ausgezeichnet zu ADHS, für den Überblick, aber auf eine greifbare Art, in der man sich zurechtfinden kann.“ Dr. med. Heiner Lachenmeier, Autor von „Mit ADHS erfolgreich im Beruf: So wandeln Sie vermeintliche Schwächen in Stärken um“
Gleich das E-Book bestellen: Hier geht es zur Bestellseite des E-Books (9,70 EUR)
Ausführliche Informationen über mentale Gesundheit
Psychische Gesundheit mit dem Klassiker aus der Selbsthilfeliteratur „Gedankenwohnung“: Selbsthilfe (Self-Help) nutzen. Stress und Herausforderungen besser meistern. Öfter Wohlbefinden genießen. Aufdringliche Gedanken (Intrusionen) und Grübeln auf Distanz bringen. Hier finden Sie einfache und ausführliche Beschreibungen zu einem entspannten Umgang mit Gedanken, der die mentale Gesundheit fördert.
